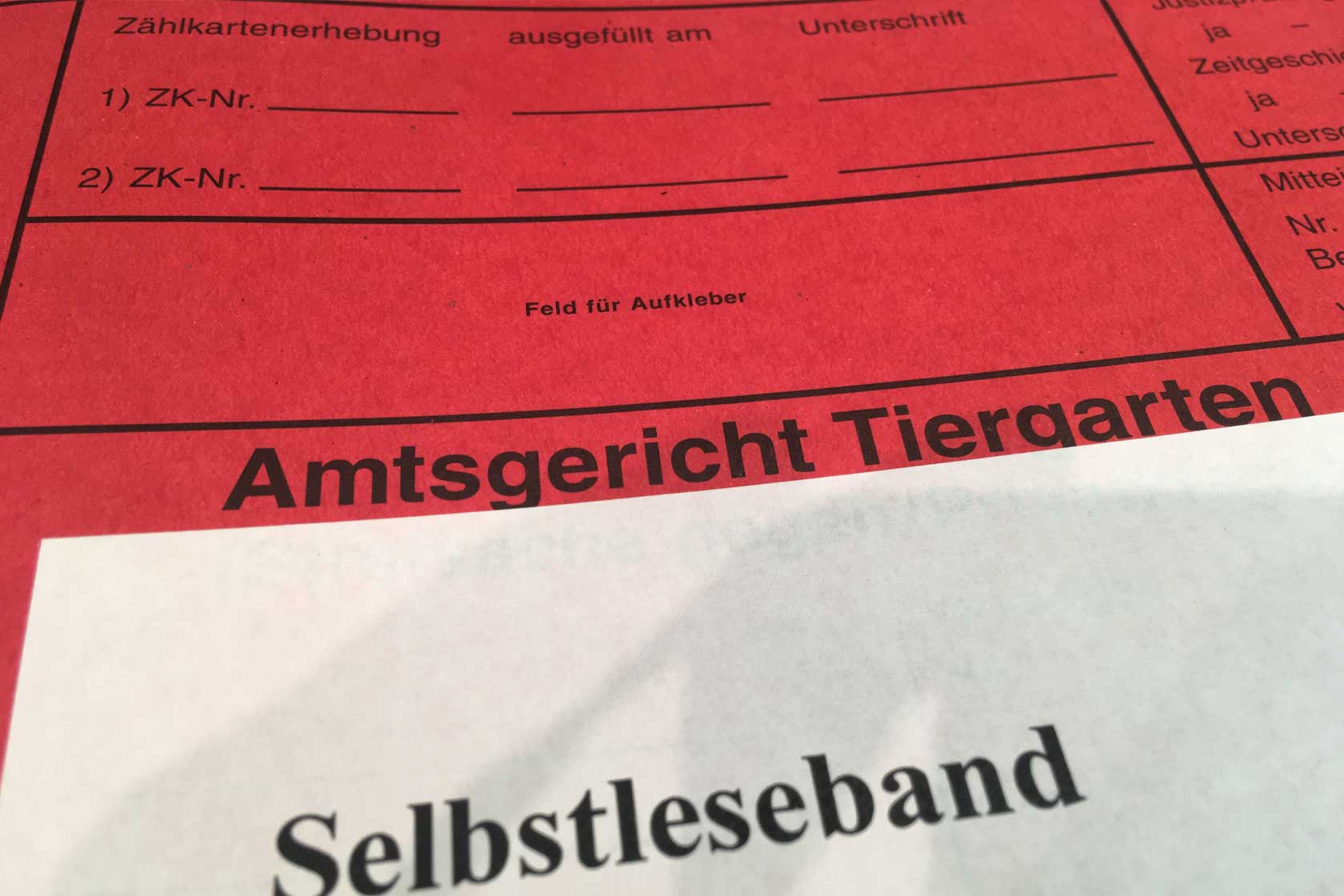Mietpreisbremse II
Die Pressestelle der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Berlin hat am 11.12.17 mitgeteilt, dass mit Beschluss des Landgerichts Berlin vom 7.12.2017 (67 S 218/17) dem Bundesverfassungsgericht die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift § 556d BGB (sog. Mietpreisbremse) vorgelegt wurde, da das Landgericht diese Vorschrift für verfassungswidrig hält – anders als die Zivilkammer 65 des LG Berlin.
Die Zivilkammer 67 hingegen rügt, dass die Vorschrift (auch) gegen das im Grundgesetz verankerte Bestimmtheitsgebot verstoße. Die Länder sind nach dem Bundesgesetz nicht verpflichtet, die Vorschrift in Landesrecht umzusetzen, weswegen in Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland sowie in Sachsen und Sachsen-Anhalt die Vermieter von einer Mietpreisbremse verschont blieben. Das gelte aller Voraussicht nach demnächst auch für die Vermieter in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, da diese Landesregierungen -nach veränderten politischen Mehrheitsverhältnissen – auch bereits erlassene Verordnungen wieder aufheben wollen. In Bundesländern wie Berlin dagegen unterfallen die Vermieter dem angeordneten Preisstopp.
Dies führe durch ein uneinheitlich bindendes Regelungssystem zu einem verfassungsmäßigen Verstoß des Bundesgesetzgebers gegen das am Gesamtstaat zu messende Gleichheitsgebot und das Bestimmtheitsgebot.
Es liegt noch keine schriftliche Begründung des Beschlusses vor.
Wir beraten Sie in allen mietrechtlichen Fragen: Kontakt